Operationen stellen große Anforderungen an Können und Fachwissen. Bei uns können Sie sicher sein, dass jeder Eingriff von uns persönlich und mit hoher Fachkompetenz durchgeführt wird. Wir verlieren nie den Respekt von einem operativen Eingriff, sei er noch so perfekt durchgeführt. Wir prüfen daher stets alternative Möglichkeiten und stimmen diese individuell mit Ihnen ab.
Falls ein operativer Eingriff notwendig ist, begleiten wir Sie Schritt-für-Schritt und alles aus einer Hand: Natürlich inklusive der individuellen operativen Nachversorgung.

Arthroskopien des Schultergelenks sind minimal-invasive chirurgische Eingriffe. Wir führen sie durch, wenn ein Impingementsyndrom, eine Rotatorenmanschettenrekonstruktion, eine Läsion der Rotatorenmanschette, eine Schultergelenksluxation oder eine „Frozen shoulder“ vorliegt. Darüber hinaus, um freie Gelenkkörper oder hypertrophe Synovialiszotten zu entfernen.
Die Bursa subacromialis ist ein Schleimbeutel. Er befindet sich zwischen dem Schultereckgelenk und der Sehne des Musculus supraspinatus. Dank des Arthroskops ist es uns möglich, über einen kleinen Hautschnitt das Schultergelenk exakt einzusehen und Änderungen wie Verletzungen beispielsweise des Subacromialraumes zu erkennen sowie chirurgisch zu behandeln. Je nach vorliegender Veränderung sind lediglich ein bis drei kleine Hautschnitte notwendig, die über die Mikroinstrumente oder Fadenanker in das Gelenk eingebracht werden. So ist in ein und derselben Narkose die Diagnose und gleichzeitige chirurgische Behandlung möglich.
Eine Schultergelenksprothese führen wir durch bei Menschen, die im fortgeschrittenen Stadium unter einer Schulterarthrose leiden. Sie können ihren Arm nicht so bewegen wie Gesunde und empfinden Schmerzen dabei. Dabei setzen wir eine neue Kunststoffpfanne ein, welche die verschlissene Pfanne ersetzt. Den Oberarmkopf tauschen wir durch einen hoch polierten Metallkopf aus, der eine reibungsarme Bewegung ermöglicht.
Je nach Zustand unterscheiden wir bei der Endoprothetik des Schultergelenkes in anatomische und inverse Prothetik. Die Patienten erlangen nach der Operation in der Regel die volle Lebensqualität und Beweglichkeit wieder zurück.
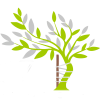

Die Implantation des künstlichen Hüftgelenks erfolgt durch unser OP-Team mit der weichteilschonenden minimalinvasiven Technik (MIS). Hierbei wird ein minimal-invasiver Eintritt zum Hüftgelenk über den direkten vorderen Zugang (anterior) oder den vorderen-seitlichen Zugang gesetzt, der zwischen den Nerven und Muskeln und verläuft. Muskeln und Nervenstränge werden beiseitegeschoben und können nicht durchtrennt werden. Die neue Hüft-Prothesenpfanne wird vom Operateur unter Sicht- und Röntgenkontrolle eingesetzt. Die OP-Methode zeichnet sich im Allgemeinen durch eine zügige Rehabilitation aus.
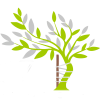

Die Kniearthroskopie ist eine schonende Operation am Kniegelenk. Sie kommt zum Beispiel bei Meniskusschäden, Kreuzbandplastiken und in der Knorpelchirurgie zum Einsatz. Bei einer Arthroskopie wird auch von einer Spiegelung des Kniegelenks gesprochen. Der minimal-invasive Eingriff wird als „schlüssellochchirurgischer Eingriff“ bezeichnet. Denn dabei wird über einen sehr kleinen Schnitt eine Minikamera in das Gelenk eingeführt. Über einen zweiten kleinen Schnitt (Arbeitskanal) kann dann mit speziellen Scheren, Stanzen und Fräsen die OP durchgeführt werden. So lassen sich verschiedene Knorpel- und Gelenkschäden im Knie beheben, ohne dass das Gelenk freigelegt werden muss.
Bei einem zerschlissenen Knie ist ein künstliches Gelenk die beste Therapie. Sie ist in der Regel die logische Konsequenz nach vielen Jahren konservativer Behandlung. Bei diesem operativen Verfahren werden das natürliche Gelenk durch eine Femur-Komponente (Oberschenkelprothese) und eine Tibiakomponente (Unterschenkelprothese) ersetzt. Zwischen diesen beiden Komponenten wird ein Gleitkern aus dem Kunststoff Polyethylen eingebracht. Dieser hat die Funktion einer Gleitfläche zwischen den beiden implantierten Gelenkteilen. Letztere werden mit speziellem Knochenzement eingebracht. Der Vorteil ist, dass dieser Oberflächenersatz modular aus einzelnen Elementen zusammengesetzt ist. So lässt sich die ursprüngliche Anatomie des Knies erhalten und kann wieder rekonstruiert werden. Die einzelnen Komponenten sind sehr leicht, sodass nach der Operation kein Schweregefühl da ist.
Knorpelschäden am Knie kommen recht häufig vor. Meistens liegt der Grund in Abnutzungserscheinungen. Auch ein Unfall kann die isolierten, umschriebenen Knorpelschäden hervorrufen – abhängig vom Beschwerdegrad und anderen Faktoren führen wir folgende Maßnahmen durch:
– Mikrofrakturierung: Dabei werden mit kleinen Bohrern oder Meißeln Löcher im geschädigten Areal bis in das Knochenmark geführt. Der Knochen wird zur Reparatur angeregt, bei der das Regeneratgewebe den Knorpeldefekt füllt. Dieses Verfahren kombinieren wir auch in Verbindung mit dem Einbringen von Matrixgewebe. Es eignet sich für kleine Defekte bei jungen Patienten.
– Osteochondrale Transplantation: Bei größeren Defekten lässt sich ein außerhalb des Belastungsbereichs des Knies liegendes Knochen/Knorpelstück gewinnen. Dieses setzen wir in den Knorpeldefekt ein.
– Autologe Knorpelzelltransplantation: Hierbei wird ein Knorpelzellsubstrat in das Defektareal appliziert und mittels Matrix am Defektort fixiert.
Die Mediale Schlittenprothese ist ein Teilgelenkersatz der Innenseite des arthrotisch geschädigten Kniegelenks. Die Voraussetzungen reichen von der Unversehrtheit des Gelenkpartners der gegenüberliegenden Seite über eine unproblematische Knorpelsituation hinter der Kniescheibe bis hin zur Bandstabilität des Kniegelenkes. Darüber hinaus sollten keine Schlittenprothesen-Operationen bei einem gerissenen vorderen Kreuzband, einer chronisch rheumatischen Gelenkentzündung, Osteoporose und einem deutlichen Übergewicht erfolgen. Bei der Operation erfolgt der Hautschnitt neben der Kniescheibensehne über der Gelenkseite. Bei ausreichender Bandstabilität setzen wir die Originalkomponenten zunächst am Schienbein – und nach Aushärtung des Knochenzements am Oberschenkel ein. Für die ersten zwei Wochen nach der OP empfehlen wir das Gehen auf Unterarmgelenkstützen.
Schäden im Kniegelenk entstehen häufig durch eine Fehlstellung wie einer X- oder O-Beinstellung. So werden die Gelenkflächen des Knies ungleichmäßig beansprucht. Eine Umstellungsosteotomie ist ein Eingriff, der durchgeführt wird, um bereits geschädigte Gelenkanteile zu entlasten. Bei der Umstellungsosteotomie korrigieren wir die Beinachse im Bereich des Schienbeinkopfes und legen die Hauptbelastungsachse auf den intakten Anteil des Gelenks. Hierfür wird der Knochen teilweise durchtrennt, geöffnet und mittels einer Platte und Schrauben stabilisiert.
Eine Operation am MPFL (mediales patellofemorale Ligament) oder MPFL-Plastik wird durchgeführt, wenn das Herausspringen der Kniescheibe (Patella) Schäden an Bändern, Knochen oder Kniegelenkknorpel verursacht hat. Das MPFL-Band ist der wichtigste Weichteilstabilisator des Knies. Häufig zerreißt es jedoch beim Herausspringen der Kniescheibe aus ihrem Gleitlager. Dann fehlt der Kniescheibe die stabilisierende Funktion. Deshalb empfehlen wir den MPFL-Ersatz beziehungsweise die MPFL-Plastik.
Bei der Operation kann das MPFL-Band entweder genäht oder ein MPFL-Ersatz durch eine MPFL-Plastik eingesetzt werden. Das Ziel ist, den Bewegungsumfang ohne Schmerzen wieder zu steigern und die Kniescheibe wieder zu zentrieren, sodass nach etwa sechs Wochen eine Beugung des Knies erfolgen kann.

Gelenkverschleiß an den Fußwurzelknochen entsteht in der Regel altersbedingt. Wie bei allen Arthrosen sind es auch hier die beschädigten und schließlich zerstörten Knorpelschichten. Sie führen dazu, dass die Gelenkflächen schmerzhaft aufeinander reiben. Schmerzen entstehen vor allem beim Abrollen des Fußes und im Bereich des Fußrückens. In einigen Fällen können hier auch Schwellungen auftreten. Bei einer konservativen Therapie lässt sich die Fußwurzelarthrose zunächst mit entzündungshemmenden Medikamenten lokal behandeln. Auch das Tragen von orthopädischem Schuhwerk oder eine Injektionsbehandlung kann zu einer Besserung beitragen. Hilft all dies nichts, muss die Arthrose mit einer Operation behandelt werden. Hier führen wir in der Regel eine Versteifungsoperation (Arthrodese) mit Schrauben, Platten und Drähten durch. Sie führt zu einer knöchernen Vereinigung der betroffenen Gelenke. Die Patienten werden so vom Schmerz befreit – ohne dass die Beweglichkeit eingeschränkt wird.
Mit modernen operativen Techniken lässt sich eine Arthrose beziehungsweise Verschleißerkrankung des oberen Sprunggelenks gut behandeln, sodass Spätfolgen nur in geringem Maße zu erwarten sind. Vor allem nach Unfällen besteht die Möglichkeit der Entstehung einer Arthrose. Bei fortgeschrittener Artrose im oberen Sprunggelenk gibt es zwei Therapiemöglichkeiten: Die Versteifungsoperation des Sprunggelenks oder die Implantation einer Sprunggelenksprothese. Für beide operativen Therapien bestehen bestimmte Voraussetzungen..
Bei einem zerschlissenen Knie ist ein künstliches Gelenk die beste Therapie. Sie ist in der Regel die logische Konsequenz nach vielen Jahren konservativer Behandlung. Bei diesem operativen Verfahren werden das natürliche Gelenk durch eine Femur-Komponente (Oberschenkelprothese) und eine Tibiakomponente (Unterschenkelprothese) ersetzt. Zwischen diesen beiden Komponenten wird ein Gleitkern aus dem Kunststoff Polyethylen eingebracht. Dieser hat die Funktion einer Gleitfläche zwischen den beiden implantierten Gelenkteilen. Letztere werden mit speziellem Knochenzement eingebracht. Der Vorteil ist, dass dieser Oberflächenersatz modular aus einzelnen Elementen zusammengesetzt ist. So lässt sich die ursprüngliche Anatomie des Knies erhalten und kann wieder rekonstruiert werden. Die einzelnen Komponenten sind sehr leicht, sodass nach der Operation kein Schweregefühl da ist.
Ein Ersatz des oberen Sprunggelenkes mit einer Endoprothese ist dann sinnvoll, wenn beim Patienten eine Arthrose vorliegt und andere operative Maßnahmen oder weitere Alternativen keinen Erfolg mehr versprechen. Hier sind eine korrekte Gelenkstellung und eine gute Beweglichkeit des oberen Sprunggelenks entscheidend. Die Operationsdauer beträgt etwa ein bis zwei Stunden. Sechs Wochen nach der Implantation einer Sprunggelenksprothese findet eine entsprechende Reha-Maßnahme statt.
Der Hallux rigidus bezeichnet einen ausgeprägten Verschleiß des Großzehengrundgelenkes. Dieser macht sich bemerkbar durch Knochenwucherungen und oftmals nur noch unvollständigem oder nicht mehr vorhandenem Knorpelüberzug an den Gelenkflächen. Hinzu kommt eine fast aufgehobene Beweglichkeit im Großzehengrundgelenk.
Cheilektomie
Bei zunehmendem Verschleiß im Großzehengrundgelenk kommt es durch die damit entstehenden knöchernen Anbauten zu einer Bewegungseinschränkung. Der Abrollvorgang ist dabei beeinträchtigt. Oft lassen sich die Knochenwucherungen am Fußrücken sehen und fühlen. Sie werden bei der Cheilektomie entfernt. Das Ziel dieser Operationsmethode ist eine verbesserte Beweglichkeit und eine Schmerzreduktion im Großzehengrundgelenk.
Arthrodese des Großzehengrundgelenkes
Die Versteifungsoperation des Großzehengrundgelenkes erfolgt mit dem Ziel eines beschwerdefreien Abrollvorgangs unter Berücksichtigung der Fußgeometrie.
Die Versteifung (Arthrodese) erfolgt mittels zweier Titanschrauben oder einer Titanplatte. Die Nachbehandlung wird mit einem speziellen Schuh, einem Vorfußentlastungsschuh über sechs Wochen durchgeführt. In diesem Schuh ist eine Vollbelastung möglich. Die Entfernung der Hautfäden erfolgt nach 12-14 Tagen.
Der Hallux Valgus ist eine Fehlstellung der Großzehe, hin zu den kleineren Zehen. Der Ballen, beziehungsweise das Köpfchen des ersten Mittelfußknochens, bildet dabei häufig eine druckschmerzhafte Vorwölbung nach außen. Unterschieden werden die Operationsmethoden von der Art und Lokalisation der Knochendurchtrennung. Das Ziel dabei ist immer, die Großzehe in die korrekte Stellung zu bringen und damit auch die Gelenkachse wiederherzustellen. Welches Operationsverfahren gewählt wird, hängt von einigen Faktoren ab, wie Alter des Patienten, Ausmaß der Fehlstellung und von dem Verschleiß der beteiligten Gelenkflächen.
Operation nach McBride
Dieses Operationsverfahren zur Korrektur der Fehlstellung an der Großzehe wird häufig bei jüngeren Patienten durchgeführt, die nur eine mäßige Fehlstellung aufweisen. Es erfolgt ein Weichteileingriff mit Verlagerung von Sehnen.
Distale Korrekturosteotomie nach Reverdin Green
Bei dieser sehr häufig von uns angewandten Methode erfolgt eine dreidimensionale Korrektur kurz unterhalb des Köpfchens des ersten Mittelfußknochens. Dafür wird der Knochen unterhalb des Mittelfußköpfchens teilweise durchtrennt, ein kleiner Knochenkeil entnommen und dann durch Verschiebung des Mittelfußköpfchens eine korrekte Gelenkachse wiederhergestellt. Das Korrekturergebnis wird daraufhin mit einer oder zwei Titanschrauben fixiert. Diese Schrauben können nach der Operation im Knochen verbleiben, müssen also nicht nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt werden. Diese Methode lässt sich mit anderen Eingriffen am Vorfuß verbinden.
Operation nach Akin
Bei angeborener oder anlagebedingter Fehlstellung im Großzehengrundgelenk, also beim sogenannten Hallux valgus interphalangeus führen wir oft diese Operationsmethode durch. Gelegentlich auch in Kombination mit anderen Korrekturoperationen an der Großzehe.
Die Nachbehandlung erfolgt in einem Spezialschuh (Vorfußentlastungsschuh), der für sechs Wochen getragen werden muss. Zusätzlich sollte postoperativ eine Nachlagerungsschiene für drei Monate getragen werden. Die Entfernung der Hautfäden erfolgt nach 12-14 Tagen.
Krallenzehe
Unter einer Krallenzehe versteht die Medizin eine Fehlstellung in beiden Gelenken der Zehe. Dies wird deutlich durch eine Überstreckung im Grundgelenk sowie eine verstärkte Beugung im Mittelgelenk. Hierdurch entsteht häufig eine schmerzhafte Schwiele (sog. Clavus „Hühnerauge“) auf dem Mittelgelenk der Zehe. Die Fehlstellung der Zehe führt oftmals zu Schmerzen im Schuhwerk. Durch Zehenrichter und/oder eine Einlagenversorgung lassen sich diese Beschwerden mindern. Kommt es zu keiner langfristigen Verbesserung der Symptomatik, ist eine korrigierende Operation angezeigt.
Für die Wahl des Operationsverfahrens oder der Kombination aus mehreren Verfahren sollte die klinische Untersuchung des Fußes mit speziellen Tests und die angefertigten Röntgenbilder die Operationsmethode festlegen. Bei einer flexiblen Fehlstellung etwa könnte eine Sehnenverlagerung ausreichen (Operation nach Girdlestone-Taylor, sog. Beugesehnentransfer).
Ist die Krallenzehe in ihrer Fehlstellung fixiert, wird eine Entfernung des Köpfchens des Grundgliedes durchgeführt (Resektionsarthroplastik nach Hohmann).
Bestehen zusätzlich oder alleine Schmerzen mit Schwielenbildung an der Fußsohle, über den Köpfchen der Mittelfußknochen, ist eine Verschiebung des Mittelfußköpfchens nach hinten die Operation der Wahl (Operation nach Weil, Verkürzungsosteotomie nach Weil). Das nach hinten versetze Mittelfußköpfchen wird mit einer kleinen Schraube fixiert. Die Schraube kann später an Ort und Stelle belassen werden. Die Nachbehandlung erfolgt meistens im Vorfußentlastungsschuh unter Vollbelastung für sechs Wochen.
Hammerzehe
Bei dieser Fehlstellung der Kleinzehen ist das Endgelenk der Zehe gebeugt und in dieser Stellung fest. Zusätzlich kann das Zehenmittelgelenk gebeugt sein. Der Patient klagt über Beschwerden durch das Laufen beziehungsweise Abrollen auf dem Zehennagel.
Das Operationsverfahren ist ähnlich zur Krallenzehe.
Der Begriff bezeichnet Schmerzen mit oder ohne Schwielenbildung unter den Mittelfußköpfchen der Zehe. Meistens ist die zweite und dritte Zehe betroffen. Es besteht eine ausgeprägte Spreizfußfehlstellung. Kommt es unter konservativen Maßnahmen mit angepasster Einlagenversorgung zu keiner dauerhaften Besserung der Beschwerden, besteht nach Anfertigung einer Röntgenaufnahme des Fußes unter Belastung häufig die Indikation zur Operation mit Verkürzungsosteotomie nach Weil (s. Krallenzeh) an den betroffenen Mittelfußköpfchen. Die Nachbehandlung wird in einem Vorfußentlastungsschuh über sechs Wochen durchgeführt.
Der Begriff bezeichnet Schmerzen mit oder ohne Schwielenbildung unter den Mittelfußköpfchen der Zehe. Meistens ist die zweite und dritte Zehe betroffen. Es besteht eine ausgeprägte Spreizfußfehlstellung. Kommt es unter konservativen Maßnahmen mit angepasster Einlagenversorgung zu keiner dauerhaften Besserung der Beschwerden, besteht nach Anfertigung einer Röntgenaufnahme des Fußes unter Belastung häufig die Indikation zur Operation mit Verkürzungsosteotomie nach Weil (s. Krallenzeh) an den betroffenen Mittelfußköpfchen. Die Nachbehandlung wird in einem Vorfußentlastungsschuh über sechs Wochen durchgeführt.
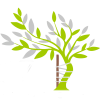
Wir benötigen Ihre Zustimmung. Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren. Hinweis zur Datenübermittlung in die USA: Indem Sie die jeweiligen Zwecke und Anbieter akzeptieren, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten möglicherweise in den USA verarbeitet werden. Diese wird vom EuGH als ein Land mit einem nach EU-Standard unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch Behörden, zu Kontroll- oder Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden können.